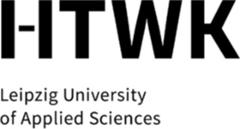
Studien- und Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik [1] [2]
-SPO-EIB-
Copyright © 2019 Fakultät Ingenieurwissenschaften
Inhaltsverzeichnis
- § Geltungsbereich
- § Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen
- § Studienziel
- § Aufbau, Inhalt und Dauer des Studiums
- § Praxisprojekt
- § Studienberatung
- § Bachelorprüfung
- § Prüfungen
- § Besondere Bestimmungen für Prüfungsvorleistungen
- § Zulassung zu Prüfungen
- § Anrechnung von Studienzeiten, Leistungsnachweisen und ECTS-Punkten
- § Bachelormodul
- § Bewertung und Notenbildung
- § Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholen
- § Versäumnis, Rücktritt und Sanktionsnote
- § Zeugnisse, Urkunden und Ungültigkeit der Bachelorprüfung
- § Prüfungsorgane und Prüfungsorganisation
- § Prüfer und Beisitzer
- § Aufbewahrung und Einsichtnahme von Prüfungsunterlagen
- § Widerspruchsverfahren
- § Überleitungs- und Schlussbestimmungen
- § A
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.
| (1) Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt das Studienziel, die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen, den Aufbau und den Inhalt sowie das Prüfungsverfahren im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik (EIB) an der Fakultät Ingenieurwissenschaften (ING) der HTWK Leipzig. |
| (2) Der Verlauf des Studiums sowie die zu erbringenden Prüfungen sind im Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan (ISP), der Bestandteil dieser Studien- und Prüfungsordnung ist (vgl Anlage 1), ausgewiesen. Hinsichtlich des Studienverlaufs hat er insoweit empfehlenden Charakter, als bei seiner Beachtung der Bachelorgrad innerhalb der Regelstudienzeit von sechs Semestern erreicht werden kann. Der Integrierte Studienablauf- und Prüfungsplan wird durch die Modulbeschreibungen (vgl Anlage 2) konkretisiert. Die Modulbeschreibungen haben informatorischen Charakter und unterliegen der stetigen Aktualisierung. Im Zweifel gelten vorrangig die Angaben in dieser Ordnung und im ISP. |
| (3) Ziel, Zulassung, Aufbau und Inhalt der in das Studium integrierten berufspraktischen Tätigkeit (Praxisphase) sind in §5 dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. |
| (4) Die zum Bestehen der Abschlussprüfung (Bachelorprüfung) erforderlichen Modulprüfungen, Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen sind semesterweise für jedes Modul getrennt im Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan ausgewiesen. Der Integrierte Studienablauf- und Prüfungsplan enthält den Namen des Moduls, die zugehörigen Prüfungen, die Prüfungsart, die für die Prüfungen notwendigen Voraussetzungen sowie die Wertigkeit in ECTS-Punkten und die Gewichtung bei der Notenbildung. |
| (1) Der Zugang und die Zulassung zum Studium bestimmt sich nach den einschlägigen hochschulrechtlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz, dem Sächsischen Hochschulzulassungsgesetz und der Sächsischen Studienplatzvergabeverordnung sowie nach der Immatrikulationsordnung und Auswahlordnung der HTWK Leipzig. |
| (2) Über die Gleichwertigkeit von nachgewiesener Vorbildung und Hochschulzugangsberechtigung entscheidet im Zweifel der Prüfungsausschuss. |
| (1) Das Studium wird in der Regel zum Wintersemester aufgenommen. | |||||
(2) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Sie basiert auf der nach Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan empfohlenen Studienabfolge. Die Studieninhalte werden in Modulen vermittelt (modularer Aufbau). Module bezeichnen einen Verbund zeitlich begrenzter, in sich geschlossener, inhaltlich oder methodisch ausgerichteter Lehrveranstaltungen. Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen, die nach Maßgabe des Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplans aus einer oder mehreren Prüfungen bestehen kann. Für erfolgreich absolvierte Module werden entsprechend ihrem hierzu erforderlichen Zeitaufwand für
| |||||
| (3) Innerhalb des Studiums ist ein Studienprofil zu wählen. Dieses ermöglicht dem Studierenden die Spezialisierung auf ein Tätigkeitsfeld. Zur Wahl stehen die in §3 Absatz 2 aufgeführten Studienprofile. Die Entscheidung für ein Studienprofil ist bis spätestens sechs Wochen nach Beginn des zweiten Semesters in Textform beim Studien- und Prüfungsamt zu beantragen. Über die Zuweisung entscheidet der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung kapazitätsbedingter Engpässe. Wählt der Studierende bis zum Ablauf der Frist kein Studienprofil, kann ihm das Studien- und Prüfungsamt von Amts wegen ein Studienprofil zuweisen. Die Zuweisung ist unanfechtbar. Ein Wechsel des Studienprofils ist einmalig möglich. Der Wechsel muss beim Studien- und Prüfungsamt schriftlich beantragt werden. Der Antrag wird durch den Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung kapazitätsbedingter Engpässe entschieden. Der Entscheid ist unanfechtbar. | |||||
| (4) Vermittlungsformen in Lehrveranstaltungen können insbesondere Vorlesungen, Übungen, Seminare und Praktika sein. Pflichtlehrveranstaltungen werden mit Ausnahme von Fremdsprachenmodulen in deutscher Sprache abgehalten, Wahlpflichtlehrveranstaltungen können bei alternativen Angeboten nach Maßgabe der Modulbeschreibung in einer Fremdsprache abgehalten werden. | |||||
| (5) Der erfolgreiche Abschluss des Studiums erfordert den Erwerb von 180 ECTS-Punkten. Nach Maßgabe des Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplanes sind dabei in den Studienprofilen Automatisierungstechnik sowie Informationstechnik und Automatisierungssysteme aus den Pflichtmodulen 160 ECTS- , aus den Wahlpflichtmodulen 20 ECTS-Punkte zu erbringen. In den Studienprofilen Elektrische Energietechnik sowie Elektronische Schatlungstechnik und Signalverarbeitung sind aus den Pflichtmodulen 165, aus den Wahlpflichtmodulen 15 ECTS-Punkte zu erbringen. | |||||
(6) Die Module werden nach
| |||||
| (7) Die Zulassung zu Wahlpflichtmodulen hat der Studierende spätestens vier Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des laufenden Semesters zu beantragen. Über die Zulassung entscheidet das Prüfungsamt unter Berücksichtigung kapazitätsbedingter Engpässe. Im Falle der Wahlmodulbelegung ergeht die Entscheidung im Einvernehmen mit der anbietenden Fakultät. Stellt der Studierende keinen Antrag, kann ihn das Prüfungsamt von Amts wegen zulassen. Die Zulassung ist unanfechtbar. | |||||
| (8) Anzahl und Inhalt der angebotenen Wahlpflichtmodule können verändert werden, wenn die Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes oder eine Verlagerung der Lehr- und Forschungsschwerpunkte dies erfordern. Werden für ein Wahlpflichtmodul nicht mindestens zehn Studierende zugelassen, kann das Wahlpflichtmodul vom Modulangebot gestrichen werden. Ein Anspruch darauf, dass der Studierende zu einem bestimmten Wahlpflichtmodul zugelassen oder ihm ein bestimmtes Wahlpflichtmodul angeboten wird, besteht nicht. Bei dem Angebot der Wahlpflichtmodule kann es aufgrund der Stundenplanung zu zeitlichen Überschneidungen kommen. | |||||
| (9) In der Regel im sechsten Semester durchläuft der Student eine 12 Wochen dauernde Praxisphase. | |||||
| (10) Während der Dauer des Studiums ist das Studium Generale als fachübergreifende Schlüsselqualifikation im Gesamtumfang von 2 ECTS zu absolvieren. Es wird empfohlen dieses Modul frühestens ab dem vierten Semester zu absolvieren. Innerhalb des Moduls stehen dem Studierenden verschiedene fachübergreifende Lernangebote zur Auswahl. Das Studium Generale ist innerhalb eines Semesters studierbar. Es kann jedoch nach Wahl des Studierenden über mehrere Semester studiert werden. Die Anerkennung absolvierter Studienleistungen auf das Studium Generale erfolgt auf Antrag des Studierenden durch das Hochschulkolleg. Ein Anspruch darauf, dass der Studierende zu einem bestimmten Lernangebot zugelassen oder ihm ein bestimmtes Lernangebot angeboten wird, besteht nicht. Die Anerkennung anderer Lernangebote erfolgt, wenn sie keine wesentlichen Unterschiede zu den vorgenannten Angeboten aufweisen. Es wird empfohlen, die Anerkennungsfähigkeit in Zweifelsfällen vor Antritt des Lernangebotes durch das Hochschulkolleg prüfen zu lassen. Im Studium Generale findet keine Prüfungsbewertung statt. Die Erreichung des Lernzieles wird durch eine Teilnahmebescheinigung (TB) nachgewiesen. | |||||
| (11) Eine Sonderform des Studiums im Studiengang EIB ist das kooperative Studium. Dieses Studium wird in Zusammenarbeit mit Industriepartnern durchgeführt. Der Studierende erwirbt parallel zum Studium die Qualifikation zum Facharbeiter. Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester einschließlich der Ausbildungs- und Praxisphasen im Ausbildungsbetrieb. Das Studium beinhaltet die gleichen Module und Prüfungsleistungen wie das grundständige Studium. Es folgt jedoch einem gesonderten zeitlichen Ablauf. Bei der Bewerbung für das kooperative Studium muss neben den in §2 definierten Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen ein Ausbildungsvertrag vorgelegt werden, der das kooperative Studium nach einem in Anlage 3 ausgewiesenen Studienablauf gewährleistet. |
| (1) Die Praxisphase im sechsten Semester umfasst mindestens 12 Wochen praktische Tätigkeit im Berufsfeld. | |||
| (2) Der Studierende schließt vor Beginn der Praxisphase mit einer geeigneten Ausbildungsstelle - nachfolgend Praxisstelle genannt - eine Ausbildungsvereinbarung ab. Muster der Ausbildungsvereinbarung, des Zeugnisses der Ausbildungsstelle und des Tätigkeitsnachweises sind im Studien- und Prüfungsamt erhältlich. Die Suche und Wahl einer Praxisstelle, der Abschluss entsprechender Ausbildungsverträge und die Beibringung aller erforderlichen Nachweise obliegen dem Studierenden. Die Praxisstelle kann ohne prüfungsrechtliche Sanktionen für den Studierenden bei inhaltlicher Fehlorientierung einmal innerhalb der ersten zwei Wochen gewechselt werden. Ein unvorhersehbarer und nicht in der Person des Praktikanten begründeter Wechsel der Praxisstelle ist nach Absprache mit dem Studien- und Prüfungsamt möglich. | |||
| (3) Das Praxisprojekt wird von einem Professor der Fakultät Ingenieurwissenschaften (ING) der HTWK Leipzig und der Praxisstelle gemeinsam betreut. Die Praxisstelle gewährleistet die im Ausbildungsvertrag festgelegten Bedingungen und sichert, dass der Studierende entsprechend der Ausbildungsvereinbarung eingesetzt wird. Die Praxisstelle soll dem Studierenden einen qualifizierten Tätigkeitsnachweis inkl. Arbeitszeugnis ausstellen. Die Hochschule erhält einen Tätigkeitsnachweis aus dem sich Umfang, Dauer und Art der ausgeübten Tätigkeiten während des Praxisprojekts ergeben. | |||
(4) Das Praxisprojekt kann begonnen werden, wenn alle Modulprüfungen der ersten drei Semester laut ISP bestanden worden und nicht mehr als insgesamt drei Modulprüfungen offen sind. Das Praxisprojekt ist in Form eines Berichtes zu dokumentieren, der folgende Angaben enthält:
|
| (1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch das Dezernat Studienangelegenheiten der HTWK Leipzig. Sie erstreckt sich insbesondere auf Fragen der Studienmöglichkeiten, der Immatrikulation, Exmatrikulation und Beurlaubung sowie auf allgemeine studentische Angelegenheiten. |
| (2) Die studienbegleitende fachliche und organisatorische Beratung wird in Verantwortung der Fakultät durchgeführt. Sie umfasst insbesondere Fragen zu Modulinhalten und zum Studienablauf. Im Rahmen vorhandener Kapazitäten finden, insbesondere zur Unterstützung von Studienanfängern, Tutorien statt. |
| (3) In prüfungsrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere zum Vorgehen gegen belastende Entscheidungen der HTWK Leipzig, berät der Justitiar. |
| (4) Wer nicht spätestens in der Prüfungsperiode des zweiten Semesters wenigstens einen Prüfungsversuch unternommen hat, muss sich einer Beratung nach Absatz 2 Satz 1 unterziehen. |
| (1) Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob der Studierende das Studienziel erreicht hat. Mit Bestehen der Bachelorprüfung wird der Bachelorgrad (Bachelor of Engineering, abgekürzt B.Eng.) als erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. | |||
(2) Die Bachelorprüfung ist modular aufgebaut. Sie ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die nach Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan erforderlichen Leistungsnachweise durch das Bestehen von Prüfungen
| |||
| (3) Überschreitungen der in dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelten Fristen, die der Studierende nicht zu vertreten hat, werden im Prüfungsverfahren nicht angerechnet. Satz 1 gilt bei Inanspruchnahme gesetzlich geregelter Freistellungen im Falle des Mutterschutzes, der Elternzeit oder der Pflegezeit entsprechend. Die Voraussetzungen der Nichtanrechnung hat der Studierende in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. | |||
| (4) Mit Ausnahme von Fremdsprachenmodulen und alternativen fremdsprachigen Wahlpflichtmodulen sind Leistungsnachweise in deutscher Sprache zu erbringen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. |
| (1) In Prüfungen wird dem Studierenden eine selbst erbrachte, abgrenzbare Leistung auf der Basis einer konkreten Aufgabenstellung abgefordert. Durch das Absolvieren von Prüfungen soll der Studierende nachweisen, dass er über einen dem Studienfortschritt entsprechenden Stand von Wissen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen verfügt sowie in der Lage ist, fachbezogene Aufgabenstellungen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden erfolgreich zu bearbeiten und in angemessener Form schriftlich bzw. mündlich darzulegen oder durch Erschaffung eines Werkes zu belegen. | ||||||||||
(2) Prüfungen im Sinne dieser Ordnung sind:
| ||||||||||
(3) Prüfungen können in folgenden Prüfungsformen erbracht werden:
| ||||||||||
(4) Prüfungsvorleistungen können in folgenden Prüfungsformen erbracht werden:
| ||||||||||
| (5) Hausarbeiten, Projektarbeiten, Belege, Laborarbeiten, Referate, mündliche Prüfungen und die Verteidigung können auch als Gruppenarbeit von bis zu vier Studierenden gemeinschaftlich erbracht werden, wenn der Beitrag jedes einzelnen Studierenden nach Inhalt und Umfang in geeigneter Weise abgegrenzt wird, deutlich unterscheidbar sowie bewertbar bleibt und auch isoliert betrachtet den Anforderungen an eine entsprechende Prüfung genügt. | ||||||||||
| (6) Klausuren und Testate sind schriftliche Aufsichtsarbeiten. In Klausurarbeiten und Testaten soll der Studierende zeigen, dass er in der Lage ist, gestellte Aufgaben oder Themen in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln schriftlich zu bearbeiten. Dem Studierenden können Aufgaben oder Themen zur Auswahl gestellt werden. Die Bearbeitungszeit für Klausuren kann von 60 bis 240 Minuten betragen. Klausurarbeiten ausschließlich nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind ausgeschlossen. Die Bearbeitungszeit für Testate beträgt maximal 30 Minuten. | ||||||||||
| (7) Hausarbeiten werden vom Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. In Hausarbeiten bearbeitet der Studierende ein schriftlich vorgegebenes Thema (z.B. Planungsaufgabe, Berechnungen, Literaturrecherche) innerhalb einer vorgegebenen Frist. Mit dem Abfassen einer Hausarbeit soll der Studierende nachweisen, dass er in begrenzter Zeit ein Thema bzw. eine Aufgabe mit wissenschaftlichen Methoden seines Fachs problembewusst bearbeiten und darstellen kann. | ||||||||||
| (8) Belege werden vom Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. Durch Belege bearbeitet der Studierende vorgegebene Aufgabenstellungen oder Themen mit dem Ziel, insbesondere Lösungsansätze, Lösungswege, Erkenntnisse und Schlussfolgerungen reproduzierbar zu dokumentieren. Belege werden häufig als Varianten einer typischen wissenschaftlichen oder praktischen Aufgabenstellung durch die Studierenden bearbeitet. | ||||||||||
| (9) Projektarbeiten werden vom Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. Innerhalb von Projektarbeiten wird durch den Studierenden eine praxisnahe bzw. wissenschaftliche Aufgabenstellung bearbeitet. Während der Projektbearbeitung werden durch den Studierenden Lösungsansätze erarbeitet, realisiert und durch die schriftliche Projektarbeit dokumentiert. Integrierter Bestandteil der Projektarbeit sind Zwischen- und Abschlusspräsentationen, in denen die Ergebnisse fachlich diskutiert werden. Projektarbeiten eignen sich zur Entwicklung der Teamfähigkeit und können je nach Aufgabenstellung von maximal vier Studierenden als gemeinschaftliche Prüfungsleistung bearbeitet werden. Projektarbeiten können je nach Aufgabenstellung auch als Feld- und Fallstudien oder Planspiele durchgeführt werden. | ||||||||||
| (10) Der praktische Teil von Laborarbeiten findet als Aufsichtsarbeit statt. Der theoretische Teil wird vom Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. Laborarbeiten bestehen aus Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Laborversuchen oder Messungen. Je nach Aufgabenstellung sind die Ergebnisse der Laborarbeiten zu interpretieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. Laborarbeiten eignen sich zur Entwicklung der Teamfähigkeit und können je nach Aufgabenstellung von maximal vier Studierenden als gemeinschaftliche Prüfungsleistung bearbeitet werden. | ||||||||||
| (11) In Prüfungen am Computer werden durch den Studierenden vorgegebene Aufgabenstellungen mittels Selbstlernprogrammen oder durch Anwendung bzw. Erstellen von Programmen bearbeitet. Für diese Prüfungsform gelten die formalen Festlungen von Klausuren. | ||||||||||
| (12) Durch mündliche Prüfungen soll der Studierende nachweisen, dass er über ein ausreichendes Grundlagenwissen verfügt, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in einem logisch aufgebauten mündlichen Vortrag zu beantworten in der Lage ist. | ||||||||||
| (13) In Referaten trägt der Studierende die Ergebnisse seiner Bearbeitung einer Aufgabenstellung mündlich mit anschließender fachlicher Diskussion vor. Als Bearbeitungszeit wird im Prüfungsplan die Dauer des vorgetragenen Referates angegeben. Eine anschließende fachliche Diskussion sollte die Zeitdauer des eigentlichen mündlichen Referatsvortrags nicht überschreiten. Eine schriftliche Ausarbeitung ist nicht Bestandteil dieser Prüfungsform. Für diese Prüfungsform gelten die formalen Festlungen von mündlichen Prüfungen. | ||||||||||
| (14) Im Rahmen einer Verteidigung werden durch den Studierenden die Ergebnisse einer vorausgegangenen schriftlichen Prüfung gegenüber einem (Fach-)Publikum vorgetragen. An den Vortrag schließt sich zum Thema der Aufgabenstellung eine fachliche Diskussion mit Beantwortung themenbezogener Fragen an. Vortrag und Diskussion sollen jeweils ca. 50 % der Prüfungszeit einnehmen. Im ISP ist die komplette Dauer der Verteidigung einschließlich fachlicher Diskussion angegeben. Für diese Prüfungsform gelten die formalen Festlungen von mündlichen Prüfungen. | ||||||||||
| (15) In der Regel werden Klausurarbeiten, mündliche Prüfungen und Prüfungen am Computer jedes Semester angeboten und finden im Anschluss an die Vorlesungszeit in der jeweiligen Prüfungsperiode statt. Projektarbeiten, Laborarbeiten und Referate werden als integraler Bestandteil einer Lehrveranstaltung in der Regel im Verlauf der Vorlesungszeit absolviert. Diese Prüfungen werden nur in dem Semester angeboten, in dem das Modul nach Studienablaufplan stattfindet. Um die Arbeitslast für die Studierenden über die Vorlesungszeit hinaus auf das gesamte Semester zu verteilen, können die Prüfungsleistungen Hausarbeiten und Belege bis zum Ende des Semesters abgeben werden, in dem das jeweilige Modul absolviert wird. | ||||||||||
| (16) Für die Dauer von Aufsichtsarbeiten soll ein Prüfer erreichbar sein. Vor Beginn von Aufsichtsarbeiten hat sich der Studierende auf Verlangen der aufsichtführenden Person mit amtlichen Lichtbildausweis bzw. Studentenausweis auszuweisen. Über den Verlauf von Aufsichtsarbeiten ist von der aufsichtführenden Person eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens Angaben über Datum, Uhrzeit, Prüfungsraum, Aufsichtsführende und Dauer der Klausurarbeit enthalten sowie die wesentlichen Vorkommnisse vermerken muss. Es ist von dem Aufsichtsführenden unter Angabe des Namens zu unterschreiben. Das Prüfungsprotokoll einer mündlichen Prüfung muss Beginn und Ende der Prüfung, den Prüfungsraum, die anwesenden Prüfer und Beisitzer, den wesentlichen Prüfungsinhalt und das Prüfungsergebnis beinhalten. Es ist von mindestens einem Prüfer zu unterzeichnen. | ||||||||||
| (17) Die Termine für schriftliche Prüfungsleistungen und Modulprüfungen sind unter Angabe des Moduls, der Prüfungsart, des Prüfers und des Prüfungsraums mindestens einen Monat im Voraus durch Aushang oder Online-Veröffentlichung an der hierfür vorgesehenen Stelle in der Fakultät bekannt zu geben. Der Aushang ist zu datieren und zu unterschreiben. Er hat die Fristen für die Anmeldung zu und die Abmeldung von Prüfungen anzugeben. An- und Abmeldefristen müssen mindestens zwei Wochen betragen. Fristbeginn ist der auf das Aushangdatum folgende Tag. | ||||||||||
| (18) Macht ein Studierender glaubhaft, dass er wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, Prüfungen unter den vorgegebenen Bedingungen abzulegen, entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag über die Gewährung eines geeigneten Nachteilsausgleichs. Dem Studierenden kann insbesondere eine verlängerte Bearbeitungszeit bzw. die Erbringung der Prüfung in einer anderen Prüfungsart gestattet werden. In Zweifelsfällen kann der Prüfungsausschuss die Beibringung eines (amts-) ärztlichen Attestes verlangen. |
| (1) Prüfungstermine von Prüfungsvorleistungen werden in den jeweiligen Veranstaltungen vom Prüfer bekanntgegeben. |
| (2) Hausarbeiten, Belege, Projektarbeiten, Laborarbeiten und Referate als Prüfungsvorleistungen sollen in der Regel semesterbegleitend bearbeitet werden. Werden diese Prüfungsvorleistungen nicht semesterbegleitend bearbeitet, sind deren Aufgabenstellungen bis spätestens sechs Wochen vor Vorlesungsende auszugeben. |
| (3) Prüfungsvorleistungen unterliegen nicht der Protokollpflicht und der Prüfung durch zwei Prüfer. |
| (4) Die Ergebnisse der Prüfungsvorleistungen sollen bis spätestens zwei Wochen vor dem Vorlesungsende bekannt gegeben werden. |
| (1) Die Zulassung zu einer Prüfung setzt voraus, dass der Studierende im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik der HTWK Leipzig immatrikuliert ist. Bestimmungen über die Wahlfachhörerschaft, das Frühstudium und das Externat nach der Immatrikulationsordnung der HTWK Leipzig bleiben hiervon unberührt. | |||
| (2) Die Zulassung zu Prüfungen nach Maßgabe des Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplans erfolgt von Amts wegen. Die (Nicht-) Zulassung wird durch Aushang oder Online-Veröffentlichung an der hierfür vorgesehenen Stelle in der Fakultät oder in sonst geeigneter Weise, in der Regel zusammen mit den Prüfungsterminen, bekannt gegeben. | |||
(3) Die Zulassung zu einer Prüfung kann insbesondere versagt werden, wenn
| |||
| (4) Studierende sind zu allen Erstprüfungen und Ersten Wiederholungsprüfungen, für die sie zugelassen sind, automatisch angemeldet. Für Prüfungen, die während einer Beurlaubung oder innerhalb der Praxisphase abgelegt werden sollen, hat sich der Studierende im Prüfungsamt schriftlich anzumelden. Mit Beantragung einer Zweiten Wiederholungsprüfung ist der Studierende automatisch angemeldet. | |||
| (5) Studierende können sich von Prüfungen, zu denen sie automatisch angemeldet sind, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Prüfungsamt bis spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin abmelden. Eine Abmeldung von Zweiten Wiederholungsprüfungen ist ausgeschlossen. |
| (1) An der HTWK Leipzig oder an einer anderen Hochschule erbrachte Studienzeiten, (berufs-)praktische Tätigkeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, der Prüfungsausschuss weist wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen nach. Die Anerkennung außerhalb der HTWK Leipzig erworbener Abschlüsse zur Berücksichtigung im Rahmen der fachbezogenen Fremdsprachenausbildung erfolgt im Einvernehmen mit dem HSZ der HTWK Leipzig. |
| (2) Die Anerkennung kann nur auf Antrag des Studierenden erfolgen. Der Antrag ist schriftlich, unter Beifügung der für die Anrechnung notwendigen Unterlagen zu stellen. Er muss spätestens eine Woche nach Bekanntgabe des Erstprüfungstermins per Aushang, bei Prüfungen ohne vorherigen Aushang spätestens eine Woche vor dem Erstprüfungstermin der Prüfung, hinsichtlich der die Anrechnung erfolgen soll, beim Prüfungsamt eingehen. Ein solcher Antrag ersetzt nicht die Abmeldung von Prüfungen nach §10 Abs.5. Die Feststellung der Anerkennung trifft der Prüfungsausschuss. Die Anerkennung von im Ausland zu erbringenden Leistungsnachweisen kann auch vor Antritt des Auslandsaufenthalts vorweggenommen werden (Learning Agreement). |
| (3) Außerhalb von Hochschulen erbrachte Leistungen können auf Studienzeiten, (berufs)praktische Tätigkeiten, Leistungsnachweise und Leistungspunkte auf Antrag des Studierenden angerechnet werden. Der Antrag ist schriftlich, unter Beifügung der für die Anrechnung notwendigen und geeigneten Unterlagen zu stellen. Ein Anrechnungsantrag muss spätestens eine Woche vor dem Erstprüfungstermin der Prüfung, hinsichtlich der die Anrechnung erfolgen soll, beim Prüfungsamt eingehen. Die Anrechnung erfolgt, soweit die Vorleistungen nach Art, Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen des Bachelorstudienganges Elektrotechnik und Informationstechnik an der HTWK Leipzig gleichwertig sind (Äquivalenz). Die Anrechnung darf nicht mehr als die Hälfte der im Studiengang zu erwerbenden Leistungspunkte betragen. Übersteigen die anrechenbaren Leistungen des Studierendenten diesen Umfang, so hat er auf Verlangen verbindlich festzulegen, auf welche Leistungen die Anrechnung erfolgen soll. |
| (4) Die Versagung der Anerkennung ist schriftlich zu begründen. |
| (5) Anrechenbare Leistungsnachweise werden mit der vergebenen Note übernommen, wenn das dabei angewandte Notensystem mit dem des Elektrotechnik und Informationstechnik der HTWK Leipzig vergleichbar ist. Andernfalls wird der Leistungsnachweis als „erfolgreich“ bewertet. |
| (1) Das Bachelormodul besteht aus der Bachelorarbeit und der Verteidigung. Aus den dabei erzielten Einzelnoten errechnet sich die Gesamtnote im Verhältnis drei zu eins. |
| (2) In der Bachelorarbeit soll der Studierende zeigen, dass er in der Lage ist, fachspezifische Probleme einer komplexen Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit wird von einem Professor oder einem anderen zur Abnahme von Prüfungen berechtigten Mitglied der HTWK Leipzig auf Vorschlag des Studierenden betreut. Die Betreuung kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. |
| (3) Der Studierende kann das Thema der Bachelorarbeit vorschlagen. Dem Vorschlag soll entsprochen werden, sofern nicht dem Thema oder den Modalitäten der Bearbeitung wichtige Gründe entgegenstehen. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit kann erst erfolgen, wenn alle Modulprüfungen der ersten drei Semester laut ISP und alle weiteren Modulprüfungen bis auf drei bestanden worden sind und die Teilnahmebescheinigung für den Besuch des Studiums Generale vorliegt. Macht der Studierende von seinem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch, wird ihm auf Antrag nach Ergebnisbekanntgabe des - abgesehen vom Bachelormodul - letzten Leistungsnachweises ein Thema zur Ausgabe zugeteilt. Die Ausgabe des Themas erfolgt über das Studien- und Prüfungsamt. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig festzuhalten. Ein ausgegebenes Thema kann auch im Wiederholungsfall insgesamt nur einmal und nur innerhalb eines Monats nach Ausgabe zurückgegeben werden. Mit der Rückgabe hat der Studierende einen alternativen Themenvorschlag einzureichen. |
| (4) Die Bachelorarbeit muss spätestens 12 Wochen nach der Ausgabe in mindestens dreifach gebundener Ausfertigung sowie auf einem elektronisch lesbaren Datenträger beim Studien- und Prüfungsamt abgegeben werden. Die Abgabe ist aktenkundig festzuhalten. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich zu versichern, dass er die Bachelorarbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Arbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. Die Bearbeitungszeit kann auf schriftlichen Antrag des Studierenden verlängert werden. Über den Antrag beschließt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem Betreuer. Eine Verlängerung darf bei Vorliegen eines besonders begründeten Ausnahmefalls nur einmalig und um maximal zwei Monate gewährt werden. |
| (5) Die Bachelorarbeit wird durch zwei Gutachter bewertet. |
| (6) Die Bachelorarbeit ist mit einer Verteidigung abzuschließen. Zur Verteidigung zugelassen wird nur, wer - neben dem Vorliegen der allgemeinen Prüfungszulassungsvoraussetzungen - eine mit der Note 4 (ausreichend) oder besser bewertete Bachelorarbeit nachweist und alle nach Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan erforderlichen Leistungsnachweise erbracht hat. Die Zulassung soll spätestens vier Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit erfolgen. |
| (7) In der Verteidigung soll der Studierende zeigen, dass er in der Lage ist, in einem Vortrag den Inhalt seiner Bachelorarbeit, die Methodik der Themenbearbeitung und die gewonnenen Ergebnisse darzustellen und zu erläutern. In einer daran anschließenden wissenschaftlichen Diskussion soll er sich Fragen zum Thema seiner Bachelorarbeit stellen. Der Vortrag soll 30 Minuten dauern, die Verteidigung insgesamt einen Zeitraum von 90 Minuten nicht überschreiten. |
| (8) Die Verteidigung wird durch eine vom Prüfungsausschuss zu bestellende Gruppe von Prüfern (Prüfungskommission) durchgeführt. Der Prüfungskommission soll mindestens ein Prüfer der Bachelorarbeit angehören. Sie wird durch einen Professor der HTWK Leipzig als Vorsitzenden geleitet. |
| (1) Die Bewertung und Ergebnisbekanntgabe von Prüfungen soll schnell und in für den Studierenden nachvollziehbarer Weise erfolgen. Die Bewertung schriftlicher Prüfungen ist stets, die Bewertung mündlicher Prüfungen auf Verlangen des Studierenden schriftlich zu begründen. Die Bachelorarbeit soll spätestens vier Wochen, sonstige schriftliche Prüfungen sollen spätestens sechs Wochen nach Abgabe bewertet sein. | ||||||||||||||||||
| (2) Zweite Wiederholungsprüfungen werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Mündliche Prüfungen sollen von mindestens zwei Prüfern oder von einem Prüfer in Anwesenheit eines sachkundigen Beisitzers bewertet werden. Die Bachelorarbeit muss von zwei Prüfern bewertet werden. Einer der Gutachter ist der Betreuer der Bachelorarbeit von der HTWK Leipzig. | ||||||||||||||||||
(3) Prüfungen können nur durch Prüfer nach folgendem Bewertungssystem bewertet werden:
| ||||||||||||||||||
| (4) Für eine Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungen (Teilprüfungen) besteht, wird aus den Bewertungen der Teilprüfungen (Einzelprüfungsnoten) eine Modulnote gebildet. Wird im Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan keine andere Gewichtung ausgewiesen, errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel der Einzelprüfungsnoten. | ||||||||||||||||||
| (5) Für eine Prüfungsleistung, die aus mehreren Prüfungsteilen und/oder Prüfungsarten (Teilleistungen) besteht, wird aus den Bewertungen der Teilleistungen (Einzelnoten) eine Gesamtnote gebildet. Wird im Integrierten Studienablauf- undPrüfungsplan keine andere Gewichtung ausgewiesen, errechnet sich die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. | ||||||||||||||||||
| (6) Eine Prüfungsvorleistung wird mit "erfolgreich" oder "nicht erfolgreich" bewertet. Die Bewertung "nicht erfolgreich" entspricht der Note 5 (nicht ausreichend). Bewertungen von Prüfungsvorleistungen werden bei nachfolgenden Notenbildungen nicht berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
(7) Im Falle der Modul- oder Gesamtnotenbildung wird nur die erste Dezimalstelle des errechneten arithmetischen oder nach Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan gewichteten Mittels berücksichtigt und ausgewiesen. Alle weiteren Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. Als Modul- oder Gesamtnote können sich damit im Durchschnitt ergeben:
| ||||||||||||||||||
| (8) 1Bewerten mehrere Prüfer eine Prüfung, ergibt sich die Gesamtbewertung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Wurde die Bachelorarbeit von nur einem Prüfer mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewertet, bestellt der Prüfungsausschuss einen dritten Prüfer. 3Vergibt auch der Drittprüfer die Note 5 (nicht ausreichend), ist die Bachelorarbeit nicht bestanden. 4In allen anderen Fällen ergibt sich die Gesamtbewertung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 5Auch wenn sich danach ein arithmetisches Mittel größer als 4,0 errechnet, wird die Bachelorarbeit mit der Note 4 (ausreichend) bewertet. 6 Absatz 7 gilt entsprechend. | ||||||||||||||||||
| (9) 1Aus dem nach Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan entsprechend der zu vergebenden Leistungspunkte gewichteten Mittel aller Modulnoten errechnet sich die Abschlussnote der Bachelorprüfung. 2 § 13, Absatz 7 gilt entsprechend. 3Neben der Abschlussnote wird zusätzlich eine Notenvergleichstabelle nach den aktuellen Empfehlungen der ECTS-Users' Guide auf der Grundlage des Abschlussjahrganges und zwei vorhergehender Jahrgänge im Diploma Supplement ausgewiesen. |
| (1) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note 4 (ausreichend) oder besser erreicht wurde. Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche nach Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan erforderlichen Modulprüfungen bestanden sind. Im Falle des Bestehens einer Modulprüfung werden Leistungspunkte erworben. Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. |
| (2) Setzt sich eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungen zusammen, kann das Bestehen der Modulprüfung nach Maßgabe des Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplans davon abhängen, dass bestimmte Prüfungen mit der Note 4 (ausreichend) oder besser bewertet werden. Andernfalls können nicht bestandene Prüfungen insoweit ausgeglichen werden, als das nach § 13, Absatz 4 errechnete Mittel aller Prüfungen die Note 4 (ausreichend) oder besser ergibt (Kompensation). Die nicht kompensierbaren Prüfungsleistungen ergeben sich aus den jeweiligen Modulbeschreibungen und dem Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan. Wird eine aus mehreren Prüfungen zusammengesetzte Modulprüfung nicht bestanden, sind nur die nicht bestandenen Prüfungen zu wiederholen. |
| (3) Eine Prüfung, für die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit ein Erstversuch unternommen wurde (Erstprüfung), gilt als nicht bestanden. Als nicht bestanden geltende Erstprüfungen werden mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewertet. |
| (4) Eine nicht bestandene Erstprüfung muss innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses wiederholt werden (Erste Wiederholungsprüfung). Die Jahresfrist gilt als gewahrt, wenn die Erste Wiederholungsprüfung in der auf die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses folgenden übernächsten Prüfungsperiode abgelegt wird. Nach Ablauf der Frist gilt die Erste Wiederholungsprüfung als nicht bestanden. |
| (5) Die Zulassung zur Wiederholung einer Ersten Wiederholungsprüfung (Zweite Wiederholungsprüfung) bedarf einer schriftlichen Antragstellung. Der Antrag muss spätestens einen Monat nach Ablauf der auf die Bekanntgabe des Ergebnisses der Ersten Wiederholungsprüfung folgenden Prüfungsperiode beim Prüfungsamt eingehen. Zugelassen wird nur zu dem auf die Antragstellung folgenden nächstmöglichen individuellen Prüfungstermin. Absatz 4 gilt entsprechend. Mit Nichtbestehen einer Zweiten Wiederholungsprüfung ist die Prüfung endgültig nicht bestanden. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. |
| (6) Wurde die Abschlussprüfung nicht bestanden, wird dem Studierenden auf schriftlichen Antrag vom Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen und die erworbenen Leistungspunkte ausgestellt. Der Studierende erhält eine Exmatrikulationsbescheinigung, sobald er ein vollständig ausgefülltes Abmeldeformular (Laufzettel) im Dezernat Studienangelegenheiten abgegeben hat. |
| (1) 1Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Studierende in einem Prüfungstermin, zu dem er angemeldet ist, unentschuldigt fehlt oder wenn er eine festgelegte Bearbeitungszeit ohne hinreichenden Grund überschreitet (Versäumnis). 2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Studierende eine begonnene Prüfung ohne triftigen Grund vorzeitig abbricht (Rücktritt). |
| (2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Grund ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf des dritten auf den Prüfungstermin oder das Ende der Bearbeitungszeit folgenden Werktags, schriftlich gegenüber dem Studien- und Prüfungsamt glaubhaft zu machen. Ein Rücktritt nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist ausgeschlossen. |
| (3) Im Krankheitsfall hat der Studierende innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist ein ärztliches Attest vorzulegen, aus dem nachvollziehbar hervorgeht, dass er prüfungsunfähig (gewesen) ist. In Zweifelsfällen kann das Prüfungsamt die Vorlage eines amtsärztlichen Attests verlangen. Ein Studierender gilt als prüfungsunfähig, wenn er glaubhaft macht, dass sein überwiegend von ihm allein zu versorgendes Kind krank (gewesen) ist. |
| (4) Wird der geltend gemachte Grund anerkannt, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. |
| (5) 1Eine Prüfung wird mit der Note 5 (Sanktionsnote) bewertet, wenn der Studierende versucht, das Prüfungsverfahren oder ein Prüfungsergebnis durch Drohung, Täuschung oder Benutzung unerlaubter Hilfsmittel zu beeinflussen. 2Ein Studierender, der den Ablauf einer Prüfung stört oder zu stören versucht (Ordnungsverstoß), kann von der Prüfung ausgeschlossen werden. 3In diesem Fall wird die Prüfung mit der Sanktionsnote bewertet. 4Zeit und Grund des Prüfungsausschlusses sind im Prüfungsprotokoll zu vermerken. 5In Fällen des Satz 1 ist der Student zuvor anzuhören, in Fällen von Satz 2 soll er zuvor abgemahnt werden |
(1)
1Über die bestandene Bachelorprüfung soll dem Studierenden unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des letzten Prüfungsergebnisses, ein Zeugnis in deutscher Sprache ausgehändigt. 2Das Zeugnis muss insbesondere
| ||||
| (2) Mit dem Zeugnis erhält der Studierende die Urkunde über die Verleihung des Grades "Bachelor of Engineering" (Bachelorurkunde) in deutscher und in englischer Sprache. Die Bachelorurkunde ist vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Absatz 1 Satz 5 und 6 gelten entsprechend. | ||||
| (3) Zusätzlich zu Zeugnis und Bachelorurkunde wird dem Studierenden eine detaillierte Erläuterung zu Voraussetzungen, Zielen und Inhalten des absolvierten Studiengangs in englischer Sprache (Diploma Supplement) ausgehändigt. Die Gliederung des Diploma Supplement folgt der jeweils geltenden Vorgabe der Hochschulrektorenkonferenz. Das Zeugnis kann auf Antrag ergänzend als „Transcript of Records“ in englischer Sprache ausgestellt werden. | ||||
| (4) Die Bachelorprüfung kann nach Anhörung des Studierenden für "nicht bestanden" erklärt werden, wenn erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, dass die Vergabe der Sanktionsnote nach § 15, Absatz 5 Satz 1 rechtfertigende Umstände vorgelegen haben. | ||||
| (5) Zeugnisse, Bachelorurkunden, Diploma Supplements und Transcript of Records werden durch das Prüfungsamt ausgestellt. Das Prüfungsamt kann die Herausgabe fehlerhafter oder inhaltlich falscher Zeugnisse, Bachelorurkunden, Diploma Supplements und Transcript of Records verlangen. |
| (1) Prüfungsorgane sind der Prüfungsausschuss und das Prüfungsamt. |
| (2) Der Fakultätsrat bestellt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter. Dem Prüfungsausschuss gehören drei Professoren und ein Studierender an. Der Fakultätsrat bestimmt den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter aus dem Kreis der Professoren. Die Amtszeit der Professoren beträgt drei Jahre, die des Studierenden ein Jahr. Die Wiederwahl ist möglich. |
| (3) 1Soweit nicht anders bestimmt, ist der Prüfungsausschuss in allen diese Studien- und Prüfungsordnung berührenden Fragen zuständig. 2Insbesondere überwacht er die Einhaltung der hier getroffenen Regelungen und befindet über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. 3Der Prüfungsausschuss kann Verfügungen und Auflagen erlassen oder sonstige erforderliche Maßnahmen treffen, um zu gewährleisten, dass die Studierenden ihre Prüfungen in der vorgesehenen Zeit ablegen können. 4Er kann einzelne Aufgaben seinem Vorsitzenden übertragen. |
| (4) Der Prüfungsausschuss tagt mindestens einmal pro Semester. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind den Betroffenen in der Regel schriftlich mitzuteilen. Die Ablehnung von Anträgen ist zu begründen. |
| (5) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. 2 Satz 1 gilt nicht für studentische Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich in demselben Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. |
| (6) Der Prüfungsausschuss tagt nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. |
| (7) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere zur Prüfungsorganisation, bedient sich der Prüfungsausschuss eines Prüfungsamtes. Er kann dem Prüfungsamt die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben dauerhaft übertragen. Im Zusammenhang mit Zulassung zur und Anerkennung des Praxisprojektes können Aufgaben des Prüfungsamtes auf ein Praktikantenamt übertragen werden. |
| (1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Die Bestellung kann für maximal ein Studienjahr im Voraus erfolgen. |
| (2) Zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer die Voraussetzungen nach § 35 Abs. 6 SächsHSFG erfüllt. Dem Prüfer obliegt die ordnungsgemäße Durchführung und Bewertung von Prüfungen. |
| (3) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mit dieser Studien- und Prüfungsordnung vertraut ist und die für den jeweiligen Prüfungsgegenstand erforderliche Sachkunde besitzt. Der Beisitzer unterstützt den Prüfer administrativ. Dem Beisitzer steht weder ein Bewertungsrecht noch ein Frage- oder Aufgabenstellungsrecht zu. |
| (4) Prüfer und Beisitzer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. |
| (1) Einen Studierenden betreffende schriftliche Prüfungsarbeiten, Bewertungsgutachten und Prüfungsprotokolle (Prüfungsunterlagen) werden mindestens fünf Jahre ab Ende des Semesters, in welchem der Studierende den letzten Prüfungstermin wahrgenommen hat, aufbewahrt. |
| (2) Studierenden wird innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der entsprechenden Prüfungsergebnisse Einsicht in die Prüfunsunterlagen gewährt. Ort und Zeit der Einsichtnahme legt der Prüfer im Benehmen mit dem Studierenden fest. |
| (1) Das Widerspruchsverfahren findet hinsichtlich belastender Entscheidungen der HTWK Leipzig im Prüfungsverfahren statt. |
| (2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich beim Rektor der HTWK Leipzig oder bei der Stelle, welche die Entscheidung getroffen hat, zu erheben. Der Widerspruch kann auch zur Niederschrift des Justitiars der HTWK Leipzig erhoben werden. Der Widerspruch kann innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Entscheidung erhoben werden, wenn eine Belehrung des Studenten über die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs unterblieben ist (§ 58 VwGO). |
| (3) Der Studierende ist zur verfahrensrechtlichen Mitwirkung verpflichtet, weshalb Widersprüche begründet werden sollen. Im Falle der Widerspruchserhebung gegen eine Prüfungsbewertung bedarf es der nachvollziehbaren Darlegung eines Bewertungsfehlers und/oder der begründeten Behauptung der Verletzung einer wesentlichen Vorschrift des Prüfungsverfahrens. Die Verletzung dieser Vorschrift muss ursächlich für die angegriffene Prüfungsbewertung gewesen sein oder es darf nicht auszuschließen sein, dass sie hätte ursächlich gewesen sein können. |
| (4) Soweit dem Widerspruch stattgegeben wird, entscheidet der Prüfungsausschuss durch Abhilfebescheid. Kann dem Widerspruch nicht abgeholfen werden, ergeht ein Widerspruchsbescheid. Diesen erlässt der Rektor der HTWK Leipzig. Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und dem Studierenden zuzustellen. Der Widerspruchsbescheid legt fest, wer die Kosten des Verfahrens trägt. |
| (5) Gegen die belastende Entscheidung und den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Leipzig erhoben werden. |
| (1) Die in dieser Studien- und Prüfungsordnung genannten Fristen sind, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, Ausschlussfristen. |
| (2) Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik wurde am 03.07.2019 vom Fakultätsrat der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) beschlossen. Sie tritt am Tage nach der Genehmigung durch das Rektorat in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2019/20 aufnehmen. |
| (3) Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik wird im Internetportal der HTWK Leipzig unter www.htwk-leipzig.de veröffentlicht. |
Leipzig, den 09.07.2019
....................................................
Prof. Dr. p.h. habil. Gesine Grande
Rektorin
[1] Fassung vom 28.06.2019 auf der Grundlage von §§ 13 Absatz 4, 16 Abs. 3,34 und 36 SächsHSFG
[2] genehmigt durch den Beschluss vom 09.07.2019
[3] Der Studiengang war zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT) zugeordnet.
[4] Durch Zusammenschluss mit Wirkung zum 01.04.2019 trat die Fakultät Ingenieurwissenschaften in Rechtsnachfolge zur Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EIT).